Mit einer Fussnote von Margot Zanni und einem Fragebogen von Michèle Novak.
Was macht das Schulfach Bildnerisches Gestalten aus? Auf welchem Wissen beruht es und welche Inhalte transportiert es mit welchem Ziel? Solche Fragen nach der Konstitution eines Faches werden in Situationen der Lehrplanrevision akut, wenn es die Substanz eines Faches zu fassen und das Fachverständnis zu aktualisieren gilt.
Die Revision ist ein Moment für Veränderung. Doch welche Veränderung genau? Was soll verändert werden und warum? Wie können wir uns darüber klar werden, was zu verändern ist und was bestehen bleibt? Und in welchen Relationen ist diese Veränderung zu verorten, wenn sie über das Fachimmanente hinaus Relevanz anstrebt und doch im Fachlichen ansetzt?
In Situationen der Lehrplanrevision sind die zeitlichen und strukturellen Vorgaben oft eng gesetzt und angesichts einer tendenziell überfordernden Sichtung des Faches als Ganzes dürften pragmatische Machbarkeitserwägungen ausschlaggebend dafür sein, wie weit die Diskussion geht – und wo sie aufhört. Doch selbst wenn die Vorgaben eng sind, setzt die Revision eine Auseinandersetzung in Gang und wirft gerade wegen deren Limitiertheit die Frage auf, welche Formen der Auseinandersetzung denn für ein grundsätzlicheres Nachdenken über das eigene Fach im Sinn einer nachhaltigen Fachentwicklung angemessen wären. In welchen Dimensionen soll sich so ein Nachdenken bewegen, wenn es über eine bildungspolitisch bedingte Pragmatik hinausgehen will, und welche theoretischen Prämissen könnten diesen Prozess anleiten?
Konkreter Ausgangspunkt, um diesen Fragen im vorliegenden Artikel nachzugehen, ist die Aktualisierung des Rahmenlehrplans für das Gymnasium, die 2020-2022 in der Schweiz ansteht. Dieser Rahmenlehrplan stellt die Grundlage für die kantonalen und standortspezifischen Lehrpläne der Maturitätsschulen dar. Das Projekt Aktualisierung des Rahmenlehrplans ist Teil des seit 2018 laufenden Projekts Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) und des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF). Über 25 Jahre nach der letzten Revision ist der Überarbeitungsbedarf unbestritten, hat sich doch unterdessen das schweizerische Bildungssystem mit der Bolognareform und der Einführung von BA- und MA-Studiengängen auf der Hochschulstufe oder mit dem Lehrplan 21 auf der Volksschulstufe stark verändert. Im Grundlagenpapier zur Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität wird betont, dass der derzeit gültige Rahmenlehrplan von 1994 überarbeitet werden müsse, weil er die Ansprüche an ein Referenzdokument für vergleichbare Maturitätsanforderungen nicht mehr erfüllt (vgl. EDK & WBF 2020: 28f und 74f). Das Sicherstellen der Anschlüsse innerhalb des Bildungssystems sowie das Festlegen von verbindlichen und vergleichbaren Anforderungen in den verschiedenen Fächern steht deshalb neben einer Überarbeitung der Lehrplaninhalte im Zentrum der Revision. In Hinblick auf die eingangs aufgeworfenen Fragen nach der Veränderung in einem Schulfach und der Ausrichtung dieser Veränderung ist jedoch insbesondere die Aussage von Interesse, dass die gymnasiale Maturität „in Zukunft durch tiefgreifende gesellschaftliche Entwicklungen herausgefordert“ sei, die bei der Feststellung des Handlungsbedarfs und der Diskussion von möglichen Veränderungen einbezogen werden müssten (vgl. EDK & WBF 2019: 20). Im Folgenden soll nun der sich in dieser Aussage manifestierende Modus, Veränderung zu denken, genauer untersucht werden. In Abgrenzung davon werde ich einen alternativen Modus vorschlagen, der eine kritische Arbeit am bestehenden kunstpädagogischen Wissen in Aussicht stellt.
Gegenwartsdiagnosen im Bildungsbereich
Leitend für den in der eben zitierten Aussage angesprochenen Umgang mit künftigen Herausforderungen sind in vielen gesellschaftlichen Bereichen sogenannte Gegenwartsdiagnosen. Darunter werden Deutungen von Gegenwart verstanden, die an einer aus dem Gegenwärtigen hochgerechneten Zukunft einen Handlungsbedarf festmachen, wie Alkemeyer et al. in interdisziplinärer Perspektive ausführen: „Sie [die Gegenwartsdiagnosen] ‚entdecken’ hier und heute bestimmte Risiken oder Entwicklungspotenziale für die Zukunft [...]: Sie betreiben deren ‚Anamnese’ und identifizieren heute sich zeigende ‚Symptome’, die es erlauben, ein Morgen zu prognostizieren und verändernd in den Gang der Dinge einzugreifen.“ (Alkemeyer/Buschmann/Etzemüller 2019: 14)
Diese gegenwartsdiagnostische Argumentationsform ist sehr prominent auch in pädagogischen und bildungspolitischen Kontexten anzutreffen, wenn es darum geht, Anhaltspunkte für die Ausrichtung zukünftiger Unterrichtsprogramme zu geben. Einige für die heutige Zeit typische Anhaltspunkte weist auch die Argumentation der Autor*innen der bereits angeführten Auslegeordnung zur Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität in ihrem Fazit auf. Allerdings sind für die weitere Auseinandersetzung damit weniger die darin angeführten Probleme und Herausforderungen an sich von Interesse. Der Fokus liegt vielmehr auf der Art und Weise der Problematisierung.
„Mit Sicherheit wissen wir: Die Maturandinnen und Maturanden müssen auf eine zunehmend komplexere Welt vorbereitet sein, die sich immer schneller verändert. Dazu müssen sie über interkulturelle und kommunikative Kompetenzen verfügen und sich mit Grundwerten und Regeln der menschlichen Gesellschaft auseinandersetzen. [...] Sie brauchen fundierte Kenntnisse, um die Herausforderungen der Digitalisierung bewältigen zu können. Sie benötigen das Wissen, das Können und den Willen, um mit den Herausforderungen der begrenzten natürlichen Ressourcen und des Klimawandels umgehen zu können.“ (EDK & WBF 2019: 25)
Dieser Auszug macht deutlich, dass Gegenwartsdiagnosen zum einen prognostizieren, welches die Herausforderungen der Zukunft sein werden und zum anderen gleichzeitig schon klarstellen, dass darauf – bspw. durch die Lehrplanrevision – eingegangen werden muss.
Diese Handlungsdimension ist denn auch konstitutiver Teil der Gegenwartsdiagnose und mit der prognostischen Dimension eng verknüpft. „In dem Maße, in dem Gegenwartsdiagnosen durch das Hochrechnen gegenwärtig festgestellter Prozesse Zukunftsszenarien entwerfen […], erzeugen sie einen Handlungsdruck, der sich auf die Gegenwart bezieht: Gehandelt werden muss hier und jetzt.“ (Alkemeyer/Buschmann/Etzemüller 2019: 16)
Der Geschichtsdidaktiker Christian Geulen problematisiert genau die enge Kopplung dieser Handlungsdimension an Zukunftsszenarien als einengend. Derzeit sei eine Form der Zukunftsorientierung vorherrschend, die unsere Denk- und Handlungsmöglichkeiten eher einschränke, statt sie zu öffnen. Er relativiert dies zwar durch das Eingeständnis, dass sich ganz ohne Zukunftserwartungen weder denken noch handeln lasse (vgl. Geulen 2020). Dennoch hält er fest: „So viel Orientierung und Halt der Glaube an eine festgelegte Zukunft auch stiftet, er blendet aus, was die Zukunft noch zu bieten hat: Spielraum, Kontingenz, Wandel, Überraschung – oder auch die Option, Gegenwart wie Zukunft nach ihrer Vergangenheit zu befragen.“ (ebd.: 6)
An der oben zitierten Passage aus dem Kontext der Maturitätsreform zeigt sich die Festlegung auf eine bestimmte Zukunft exemplarisch: Projiziert wird „eine zunehmend komplexere Welt […], die sich immer schneller verändert“ und geprägt ist durch Interkultur, Digitalisierung und Klimawandel (vgl. EDK & WBF 2019: 25). Daran wird deutlich, dass gerade die Fixierung von als relevant zu erachtenden Herausforderungen, auf die sich die Lehrer*innen und die künftigen Maturand*innen jetzt vorbereiten müssen, in der Konsequenz implizit die Kontingenz der Gegenwart wie auch das Unvorhersehbare der Zukunft in Abrede stellt. Es geht auch nicht darum, dass sich diese Herausforderungen bei einer späteren Überprüfung als zutreffend erweisen oder die damit verbundenen Probleme gelöst wurden. Vielmehr hat diese Argumentationsform eine legitimatorische Funktion und ist von einem Machbarkeits- und Veränderungsoptimismus getragen, der auch durch das oft festgestellte Scheitern von Bildungsreformen nicht zu brechen zu sein scheint.
Denn gerade im Bildungsbereich stehen Gegenwartsdiagnosen in einem eigentlichen Widerspruch zur bildungshistorischen Tatsache, dass Curricula in grossen Teilen sehr beständig sind und sich curricularer Wandel nur in geringem Mass vollzieht, weil die angestrebten Veränderungen sich nicht zu etablieren vermögen. Vor diesem Hintergrund, täuschen pädagogische Gegenwarts- oder Zeitdiagnosen gerade über die Persistenz von Bildungsprogrammen hinweg und suggerieren als notwendige Illusion eine Wandelbarkeit, wo kaum Wandel zu erwarten ist.
Der Erziehungswissenschaftler Heinz-Elmar Tenorth bemerkt hierzu selbstkritisch, statt sich vermehrt auf Erkenntnisse der empirischen oder der historischen Bildungsforschung abzustützen, erzeuge die Argumentationsform der Zeitdiagnose die Suggestion eines reflektierten Umgangs mit dem Gegebenen, erliege aber tatsächlich einem Zirkelschluss, der durch die Beobachtung von Wirklichkeit kaum zu erschüttern sei, weil für sie das Handeln letztlich wichtiger sei als Analyse (vgl. Tenorth 2019: 109). Tenorth stellt der Zeitdiagnose als Argumentationsform in der Pädagogik trotz ihrer Unentbehrlichkeit letztlich kein gutes Zeugnis aus: „In der Regel ist die Zeitdiagnose doch nur gut gemeint, Kritik in der Absicht, das eigene Programm zu rechtfertigen, Fortschreiben der Positionen, die in der Gegenwart immer schon galten und ihre eigene Tradition zur Selbstlegitimation konstruieren.“ (ebd.: 110) Da sowohl das Versprechen auf Veränderung wie auch die optimistische Behauptung, dass diese Veränderung auf validen Prognosen basiere, in bildungspolitischen Kontexten also eher eine Hülse zu sein scheint, stellt sich umso mehr die Frage, wie Veränderung in unserem Fach anders gedacht und angegangen werden kann.
Gegenwartsdiagnosen vs. Analyse des So-Gewordenen
Von Gegenwartsdiagnosen, die als handlungsleitende Entwürfe zu konkretem Intervenieren aufrufen, lassen sich andere, etwa analytische oder kritische Modi der Gegenwartsbeschreibung unterscheiden. Im Folgenden soll deshalb nun als Alternative zum Veränderungsimperativ der Gegenwartsdiagnose der kritische Modus im Sinn von Michel Foucaults Konzept einer kritischen Ontologie der Gegenwart verfolgt werden – und damit ein Ansatz, der gerade „nicht auf Imperative hin gelesen werden [kann], nicht im Sinn eines Positionsbezugs, von dem aus sich eine grosse Wahrheit eröffnet“ (Thompson 2004: 44). Im Anschluss an Christiane Thompson (2004, 2007) und Jan Masschelein (2004), die diesen Ansatz für die Bildungsphilosophie entfaltet haben, stelle ich mögliche Perspektivierungen für eine kritische Arbeit am Wissen in kunstpädagogischen Kontexten dar.
Während es Gegenwartsdiagnosen, wie oben dargestellt, darum geht, die Kontingenz auszublenden oder sogar die „Kontingenz in der Gegenwart qua Prognose der Zukunft beherrschbar zu machen“ (Alkemeyer/Buschmann/Etzemüller 2019: 13), sucht eine kritische Zugangsweise im Anschluss an Foucault die Kontingenz gerade erst sichtbar zu machen und daraus Handlungsoptionen für eine Veränderung zu gewinnen. Das Kritische wird hier verstanden als Entselbstverständlichung des Bestehenden, sprich der Gegenwart: Es muss nicht so sein.
Masschelein fasst Kritik im Sinne Foucaults „als Praxis der Aussetzung zur und in der Gegenwart“ (Masschelein/Quaghebeur/Simons 2004: 25). Voraussetzung für diese experimentelle Praxis einer „unkomfortablen Ex-position“ sei eine „Haltung, die sich nicht um Legitimierung oder Begründung [...] und um die Bestimmung und Verteidigung einer ‚Position’ kümmert“, auch nicht „um die Legitimation dessen, was ist, oder dessen, was man bereits weiss“, sondern „um ‚Erfahrung’ im Sinne von ‚dem was uns passiert’ und darauf gerichtet ist, ‚zu sagen, was man zu sagen hat’ (‚dire ce qu’on a à dire’ – Foucault)“ (ebd.: 23f). Die Aufgabe bestehe darin, „seinen Blick zu wenden, zu verschieben“ und es gehe darum „die richtigen Worte oder Taten zu finden, um sichtbar zu machen, was bereits in der Gegenwart da ist und uns ermöglicht, die Gegenwart als eine Frage erscheinen zu lassen“ (ebd.: 25).
Dabei ist es laut Thompson das Herausstellen der Brüche, der Diskontinuitäten und Kontingenzen in den Ensembles von Macht-Wissen, welches das kritische Potenzial ausmacht, indem es „ein Feld möglicher Umkehr oder Veränderung“ vorauszeichnet (Thompson 2004: 48). In den Bruchlinien, Diskontinuitäten und Kontingenzen offenbart sich das So-Geworden-Sein des Bestehenden und damit dessen historische und gesellschaftliche Bedingtheit. Die anspruchsvolle Arbeit der Kritik besteht mit Thompson darin, „die Gegebenheit der gegenwärtigen Wahrheits- und Wissensproduktion sichtbar zu machen und dadurch möglicherweise eine Verschiebung einzuleiten“ (ebd.: 52). Diese Verschiebung des Blicks auf die Gegebenheiten trägt zum transformatorischen Potential dieser kritischen Arbeit bei und sie hat mit der potenziellen Irritation, der Grenzerfahrung und dem Anders-Werden derjenigen zu tun, die eine solche Arbeit auf sich nehmen oder sie rezipieren.
„imagine a type of writing“
Bei der Erläuterung der Frage, wie dieses mit Erfahrung verbundene transformatorische Moment zu denken ist, nehmen sowohl Masschelein wie auch Thompson auf Foucaults eigene Schreibpraxis Bezug. Demnach sind seine Bücher, die er in Abgrenzung zu Wahrheits- oder Beweisbüchern als „Erfahrungsbücher“ bezeichnet, quasi performativ zu verstehen, als „Mittel, ‚zu einer Erfahrung zu gelangen, die eine Veränderung erlaubt, einen Wandel in unserem Verhältnis zu uns selbst und zur Welt dort, wo wir bisher keine Probleme sahen (in einem Wort, in unserem Verhältnis zu unserem Wissen)’“ (Masschelein 2004: 101f). Und Thomas Lemke, der sich aus soziologischer Perspektive ebenfalls mit dem Zusammenhang von Erfahrung und Kritik bei Foucault befasst, hält fest, dass Foucaults Erfahrungsbücher sich zwar mit historischen Prozessen auseinandersetzen, sich aber nicht darauf beschränken würden, sondern über die Narration dieser historischen Prozesse auf zeitgenössische Praktiken verwiesen und unseren Blick auf sie transformierten. Das Ziel dabei sei „die Problematisierung der Art, wie wir über bestimmte Gegenstände nachdenken und sie hervorbringen, um uns von ihrer scheinbaren Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit zu lösen – und auf neue Erfahrungen hinzuarbeiten“ (Lemke 2019: 32).
Thompson wiederum findet gerade in der Erfahrung, wie sie mit der lokalen und situierten Untersuchung unseres Verhältnisses zu Wahrheit und Wissen einhergeht, einen Ansatz, um den Grenzen des Wissens zu begegnen. Wie dies konkret aussehen könnte, veranschaulicht sie an einer Praxis des Schreibens, die sie exemplarisch für den Kontext des Studiums und der pädagogischen Professionalisierung vorschlägt.
„This writing could pursue a discourse analytic point of view, e.g. by carving out the self-understanding of the student as student when speaking of all upcoming issues as ‚challenges’ and ‚problems’, a self-understanding which inevitably propels the perspective of handling these issues. To simply collect the concepts students use in order to describe their studies (advancement, difficulties, challenges, multiperspectivity, time-constraints, approval, insufficiency, overload etc.) could help them to lay out the techniques they apply in order to become study active individuals […].“ (Thompson 2007: 372)
Diese Schreibpraxis soll Studierenden zu einem anderen Blick auf ihr Studium verhelfen: „Let us imagine a type of writing which […] runs in shorter or longer episodes with the aim of adopting a critical ethos and casting a side glance at the study process or progression.“ (ebd.: 372) Ausgehend von der Frage nach den Selbstverständnissen der Studierenden in der Auffassung spezifischer Aspekte ihres Studiums oder ihrer pädagogischen Tätigkeit lässt dieses Schreiben die Studierenden über diese Selbstverständnisse reflektieren und ermöglicht so eine Verschiebung, eine Selbstdistanzierung und Selbsthinterfragung. Ziel dieses Schreibens wäre es, den Schreibenden die historische und gesellschaftliche Bedingtheit der Auffassung pädagogischer Situationen bewusst zu machen. Im Lehrkontext könnte das in analoger Weise auch dazu beitragen, die Selbstverständnisse und Handlungsreferenzen im Umgang mit theoretischen Texten oder beim Einstieg in die Unterrichtspraxis zu sammeln und aufzuschlüsseln. Besonders geeignete Anlässe für dieses Schreiben wären die (singulären) Momente des Scheiterns oder des Nichtverstehens, in denen bestimmte Vorannahmen brüchig und Selbstverständnisse als solche sichtbar werden. „It could be that they come to see that our relation to the world, to others, and to ourselves does not have to be the way it is.“ (ebd.: 373)
Problematisieren, explizieren, revidieren
Wie lässt sich diese kritische Praxis nun auf das Feld der Kunstpädagogik übertragen und für eine Befragung des Faches und eine kritische Arbeit am kunstpädagogischen Wissen produktiv machen? Ausgehend von einer exemplarischen Situation aus dem Kunstunterricht möchte ich eine Antwort versuchen, indem ich skizziere, wie Kritik „als Praxis der Aussetzung zur und in der Gegenwart“ (Masschelein/Quaghebeur/Simons 2004: 25) aussehen könnte.
Alljährlich bin ich als externe Expertin mit dabei, wenn an einem Gymnasium in der Schweiz die Bewertungen von Semesterprojekten besprochen werden, welche die Gymnasiast*innen im Fach Bildnerisches Gestalten über ein halbes Jahr individuell und entsprechend selbstständig verfolgt haben. Im Zentrum dieser Besprechung stehen jeweils die schwierigen Fälle, also solche Arbeiten, die aus verschiedenen Gründen den Kriterien nicht entsprechen und deren Bewertung deshalb schlecht ausfällt oder im Lehrer*innenteam umstritten ist.
Das eigentliche Ziel der Besprechung ist es, die Bewertungen zu konsolidieren und zu begründen. Doch tatsächlich ist diese Besprechung für mich besonders interessant, weil sich dabei die Dinge zeigen, die nicht aufgehen. Wie kommt es dazu, dass Schüler*innen die Kriterien verfehlen, auch wenn sie sorgfältig in die projektartige Arbeitsweise eingeführt sind und in ihrem Prozess ebenso sorgfältig begleitet wurden? Meine Beobachtung ist, dass bei vielen dieser schlechten Bewertungen das Verfehlen von impliziten Erwartungen und Konventionen im Spiel ist, und ich vermute, dass sich gerade in Formaten wie der Projektarbeit die impliziten Vorannahmen unseres Faches besonders stark niederschlagen.
Manche Schüler*innen erhalten eine schlechte Bewertung, weil sie zu wenig erarbeitet haben. Das Semesterprojekt impliziert also bestimmte Vorstellungen davon, was in der Projektlaufzeit zu leisten und wie die Zeit dafür einzuteilen sei und was ein angemessener Umfang für das wäre, was am Ende vorliegt.
Andere Schüler*innen erhalten eine schlechte Bewertung, weil die geleistete Auseinandersetzung nicht den Erwartungen entspricht: Weil der Prozess zu wenig sichtbar wird, weil zu wenig ausprobiert oder weil Ausprobiertes zu wenig reflektiert wurde. Das Semesterprojekt impliziert also bestimmte Vorstellungen von einem gestalterischen Prozess, von den einzelnen Prozessschritten und der damit einhergehenden Differenzierung sowie von der Sichtbarmachung dieser Schritte in einer Dokumentation des projekthaften Vorgehens.
Wieder andere Schüler*innen haben zwar viel gemacht und intensiv gearbeitet, erhalten aber eine schlechte Bewertung, weil die Qualitäten ihres Produktes nicht als ausreichend erachtet werden, weil die verwendeten gestalterischen Mittel beliebig sind oder die intendierte Wirkung eine Behauptung bleibt. Das Semesterprojekt impliziert also bestimmte Vorstellungen von einer adäquaten Wahl der Mittel, von Formgebung und von konzeptueller Stringenz.
Wie liesse sich nun dieser Situation, in der das Verfehlen von Erwartungen festgestellt wird, anders begegnen als mit der Bemühung, eine schlechte, möglicherweise sogar auf „ungenügend“ lautende Beurteilung zu legitimieren? Was kann die Besprechung sichtbar machen, wenn wir diesen Moment zum Anlass nehmen, um das, was da ist, „als eine Frage erscheinen zu lassen“ (Masschelein/Quaghebeur/Simons 2004: 25), und aufhören, die darin sich manifestierende Ordnung als gegeben anzusehen? Was wird möglich, wenn die bewertenden Lehrpersonen versuchen, mittels eines Seitenblicks (a side glance „casting a side glance“ – eine Fussnote von Margot Zanni __________Der side glance wendet sich ab vom Geschehen, nimmt in den Blick, was nicht unmittelbar vorliegt. Nicht selten steht er im Dienst einer strategischen Blickverschiebung, um über einen Umweg noch einmal anders – von einem anderen Ort aus – auf die Sache zurückzublicken. Manchmal sind auch Fussnoten als solche Seitenblicke zu begreifen. Dem reflektierenden Blick zur Seite inhärent ist das Moment der räumlichen Verschiebung. Dieser Aspekt soll in der vorliegenden Fussnote thematisch werden: die Reflexivität der Gedanken dieses kurzen Textes entfaltet sich in einem gewissen Abstand, aber stets in Relation zum Haupttext. Dem Haupttext entlang flanierend greift diese Fussnote Textfragmente von ihm auf, schweift ab und kehrt zurück, nur um erneut abzuzweigen und einen eigenständigen reflektierenden Seitenarm zum Haupttext herauszubilden. Räumliche Verschiebungen sollen zugleich aber auch das Thema dieses Seitenblicks sein: Es wird gefragt, wie ausgehend von den reflektierenden Potentialen räumlicher Verschiebungen zu einem methodischen Verfahren gefunden werden könnte, um kunstpädagogischen Selbstverständnissen reflexiv zu begegnen. Oder – in den Worten des Haupttextes – um zu fragen, wie sich „Dinge zeigen [können], die nicht aufgehen“ (Schürch: 2021). Die räumlich-materielle Dimension von kunstpädagogischen Prozessen soll dabei ins Zentrum gerückt werden. In diesem Vorgehen greift mein Seitenblick ebenfalls auf die Analysen von Foucault zurück, fokussiert jedoch sein Konzept der Heterotopie. Dabei breite ich ein Argument aus, nach dem sich die Heterotopie als spezifisch räumliche Wendung von Foucaults Konzept der kritischen Ontologie der Gegenwart auffassen liesse. __________Problematisierungen impliziter kunstpädagogischer Selbstverständnisse, wie sie im Haupttext anlässlich einer Bewertungssituation Thema werden, weil sich „dabei die Dinge zeigen, die nicht aufgehen“ (ebd.) nehme ich zum Anlass, um einzusteigen resp. abzuschweifen. Dabei imaginiere ich eine konkrete Situation, die sich zugleich stark auf die materielle Dimension von Kunstunterricht bezieht: Denn Situationen, an denen sich Dinge zeigen, die nicht aufgehen, sind im Fach Bildnerisches Gestalten oft konkreter oder sozusagen selbst dinglicher Natur. Im Rahmen einer schulischen Projektpräsentation, wie sie von Anna Schürch beschrieben wird, könnte dies beispielsweise ein Sockel sein. Als eine die Präsentation rahmende Geste könnte so ein Sockel im Kontext unterschiedlicher versammelter Verständnisse von Kunst Anlass zu einer kontroversen Diskussion sein: Handelt es sich dabei um eine reflektierte Setzung oder wird im Rahmen eines klassischeren Kunstverständnisses schlicht davon ausgegangen, dass Objekte – wie Bilder im Rahmen – prinzipiell auf einem Sockel präsentiert werden sollten? Kontrovers wird dies vor allem dann, wenn diese Verständnisse unter den Beurteilenden implizit sind, und problematisch wird es, wenn sie auch bei der/dem entsprechenden Schüler*in stillschweigend vorausgesetzt wurden. Mit diesem knapp dargestellten Beispiel zeige ich, dass auch den Dingen oder Objekten – der materiellen Dimension insgesamt – implizite diskursive Strukturen hinterlegt sind, auf die in Argumentationsweisen unterschiedlich zugegriffen werden kann, um eine spezifische Ordnung der Dinge zu postulieren, resp. die Beurteilung zu legitimieren. So kann wiederum mit Blick zurück auf den Haupttext gefragt werden: „Wie liesse sich nun dieser Situation […] anders begegnen als mit der Bemühung, eine […] Beurteilung zu legitimieren?“ (Schürch 2021) Wie kann die legitimatorische Begründung abgewendet und wie können stattdessen die Bedingungen der Urteilsbildung in den Blick genommen werden? Anhaltspunkte dazu finde ich bei der Kunstpädagogin und Erziehungswissenschaftlerin Anja Kraus. Kraus nimmt die potentielle Bedeutungsoffenheit der Dinge – wie am Beispiel des Sockels ausgeführt – zum Anlass, um die Urteilsbildung selbst zum Thema zu machen: Mit Kraus impliziert etwa die Art und Weise, wie im Unterricht die Frage „was zeigen uns die Dinge?“ (Kraus 2013: 156) gestellt wird, jeweils auch eine spezifische pädagogische „Dingordnung“ (ebd.: 158). Die Frage kann eine Engführung der Bedeutung eines Dings herbeiführen und es dadurch für eine machtvolle pädagogische Geste benutzen. Oder sie kann stattdessen vom „Erschliessungscharakter der ‚Dinge’“ (ebd.: 159) – deren potentieller Mehrdeutigkeit – ausgehen und viele Antworten evozieren. Diese Mehrstimmigkeit vermag in ihrem Nebeneinander den Prozess der Bildung von Urteilen sichtbar zu machen und impliziert damit eine völlig andere pädagogische Auffassung (vgl. ebd.: 155). __________Inwiefern liessen sich nun ausgehend von den Dingen fokussiert kunstpädagogische Selbstverständnisse irritieren und reflexive Prozesse in Gang setzen? Welche methodischen Verfahren bieten sich ausgehend von der materiellen Dimension an, um – wie es der Haupttext vorschlägt – „das, was da ist, ‚als Frage erscheinen zu lassen’“ (Schürch 2021)?Das Konzept des „Displacement“, das Christiane Brohl als kunstpädagogische Strategie ausformuliert (vgl. Brohl 2003) und das Anja Kraus für weiterführende, lerntheoretische Ausführungen aufgreift (vgl. Kraus 2013: 167), lässt sich für den Brückenschlag hin zur ‚Entselbstverständlichung’ einspannen. Displacement lese ich dabei als Ausgangspunkt einer Methode für eine Irritation durch die Verschiebung der Dinge. Zentral für Brohls Konzept ist ein Foucaultscher Begriff – die Heterotopie. Bei Heterotopien handelt es sich um Räume, die sich auf andere Räume beziehen, aber in einer Art, dass sie deren Eigenschaften oder Ordnungen „suspendieren, neutralisieren oder in ihr Gegenteil verkehren“ (Foucault 1992: 38). Es sind damit relationale Räume, die einen Gegenraum eröffnen und dadurch zur Reflexion einladen. Mit in Brohls Entwicklung des Displacement als kunstpädagogischer Strategie wirkte die Auseinandersetzung mit dem Künstler Robert Smithson hinein. Mitte der 1960er Jahre wendet sich Smithson in einer institutionskritischen Geste sogenannten „nicht-institutionellen“ (Brohl 2003: 164f) Orten zu und arrangiert die von den Erkundungen amerikanischer, postindustrieller Orte mitgebrachten Erdmaterialien zusammen mit Spiegeln oder Dokumenten in Form von Fotografien, Filmen und geographischen Karten im musealen Raum zu installativen Displacements. Brohl schlägt vor, dass Schüler*innen Spuren ihrer Recherchen im öffentlichen Raum zurück im Schulraum als Displacement inszenieren. Sie lesen einen Ort „durch einen anderen Ort“ (Brohl 2008: 35). Ausgehend von diesem kunstpädagogischen Setting leite ich ab, dass die reflexiven Potentiale, die sich aus dem bedeutungsoffenen Nebeneinander unterschiedlicher Dinge, bzw. Objekte oder Materialien in einem solchen Displacement ergeben, auch für eine Befragung kunstpädagogischer Selbstverständnisse und impliziter Wissensbestände produktiv gemacht werden könnten. So könnten etwa die Hinterbühnen von Unterricht, die Materialräume und -sammlungen, die Dachböden oder die Vorbereitungszimmer von Schulhäusern als heterotope Räume zu anderen Orten ins Verhältnis gesetzt werden und durch Interventionen wie das Umstellen, Variieren oder Umräumen würde die Erfahrung einer Blickverschiebung möglich. Meiner Ansicht nach liesse sich die Heterotopie als spezifisch räumlich gewendete Perspektivierung von Foucaults Konzept der kritischen Ontologie der Gegenwart begreifen. Dies gelingt, insofern sie mittels der den bestehenden Ordnungen inhärenten Möglichkeiten die Erfahrung einer Grenzüberschreitung im Sinne eines reflexiven Möglichkeitsraumes zu eröffnen vermag (vgl. Klass 2012: 24). Vergleichbar wird dies auch im Haupttext für die kritische Ontologie der Gegenwart geltend gemacht wird. An der durch Verschiebungen der eingelagerten und aufbewahrten Dinge erzeugten Differenz könnten sich im Schulraum andere Blicke auf jene impliziten Verständnisse und Konstruktionsweisen ergeben, die diesen Anordnungen und Infrastrukturen zugrunde liegen. Im Kontext dieser Fussnote ist das Abschweifen hin zu den peripheren Räumen des Unterrichts und das Intervenieren in die dort vorgefundenen Ordnungen durchaus konkret gemeint, wenn es darum geht, dass „[...] Lehrpersonen versuchen, mittels eines Seitenblicks (a side glance) etwas anderes als die unmittelbar gegebene Situation zu erfassen [...]“ (Schürch 2021). __________Margot Zanni ist Künstlerin und Kunstpädagogin. Sie lehrt an der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsschwerpunkt Art Education. In ihrem Dissertationsprojekt forscht sie zur räumlich-materiellen Dimension kunstpädagogischen Wissens.) etwas anderes als die unmittelbar gegebene Situation zu erfassen, und sich zu fragen beginnen, von welchen Selbstverständnissen sie in diesem Fall eigentlich ausgehen? Was wäre, wenn sie anfingen, diese Selbstverständnisse zu problematisieren statt die Leistungen der Schüler*innen? Setzt man sich der Gegenwart (den Erwartungen an die Semesterprojekte) aus und nimmt die Kriterien, die mit diesem Semesterprojekt verbunden sind, nicht als per se gegeben an, sondern als so-geworden, kann man anfangen, sie anders zu sehen. Diese Kriterien verstehen sich trotz ihrer begründbaren Setzung nicht von selbst. Doch was implizieren sie alles und wie lässt sich das explizieren?
Auf all diese Fragen sind keine schnellen Antworten zu erwarten, geht es hier doch um Grundsätzliches. Mit dem Versuch zu klären, wovon wir eigentlich ausgehen und was die Voraussetzungen des eigenen fachlichen Denkens und Wissens als Lehrperson sind, beginnt vielmehr erst die Arbeit – und das gälte auch für die Lehrplanrevision, mit der dieser Text eingesetzt hat. Erforderlich ist eine Arbeit, deren Ziel Foucault bezogen auf seine eigene Schreibpraxis folgendermassen umrissen hat: „es ging darum zu wissen, in welchem Maße die Arbeit, seine eigene Geschichte zu denken, das Denken von dem lösen kann, was es im Stillen denkt, und inwieweit sie es ihm ermöglichen kann, anders zu denken.“ (Foucault zit. nach Masschelein 2004: 96)
Die durch diese radikale Selbstreflexion sichtbar werdende Möglichkeit der Veränderung habe ich aus bildungsphilosophischen Überlegungen zu einer kritischen Ontologie der Gegenwart hergeleitet. Diese kritische Ontologie der Gegenwart unterscheidet sich von einem Veränderungs- und Handlungsimperativ, wie er mit der Gegenwartsdiagnose einhergeht, die in bildungspolitischen Kontexten häufig anzutreffen ist. Der kritische Modus, Veränderung zu denken, ist „unkomfortabel“ (Masschelein et al. 2004: 22f), weil er keine klaren Vorgaben macht und auch nicht die abschliessende Lösung eines Problems in Aussicht stellt. Vielmehr ist die mit der kritischen Auseinandersetzung einhergehende Transformation unvorhersehbar und prinzipiell unabschliessbar. Sie ist dem Kontingenten verhaftet. Aber – und das interessiert mich – diese Auseinandersetzung geht in die Tiefe, an die Substanz dessen, was unser Fach ausmacht.
An der Diskussion der Bewertungen der Semesterprojekte zeigt sich meiner Ansicht nach also, wie das Problematisieren und Explizieren von implizitem Wissen zur Revision eines Faches beitragen könnte. Letztere kann im Sinne Foucaults an den konkreten Momenten der Reibung festgemacht werden, den Erfahrungen, in denen sich andere – und ich würde meinen: grundsätzlichere – Veränderungsbedarfe erkennen lassen, als sie Gegenwartsdiagnosen, denen es mehr darum geht, eine Veränderung zu legitimieren als sie fachlich zu begründen, zu fassen vermögen.
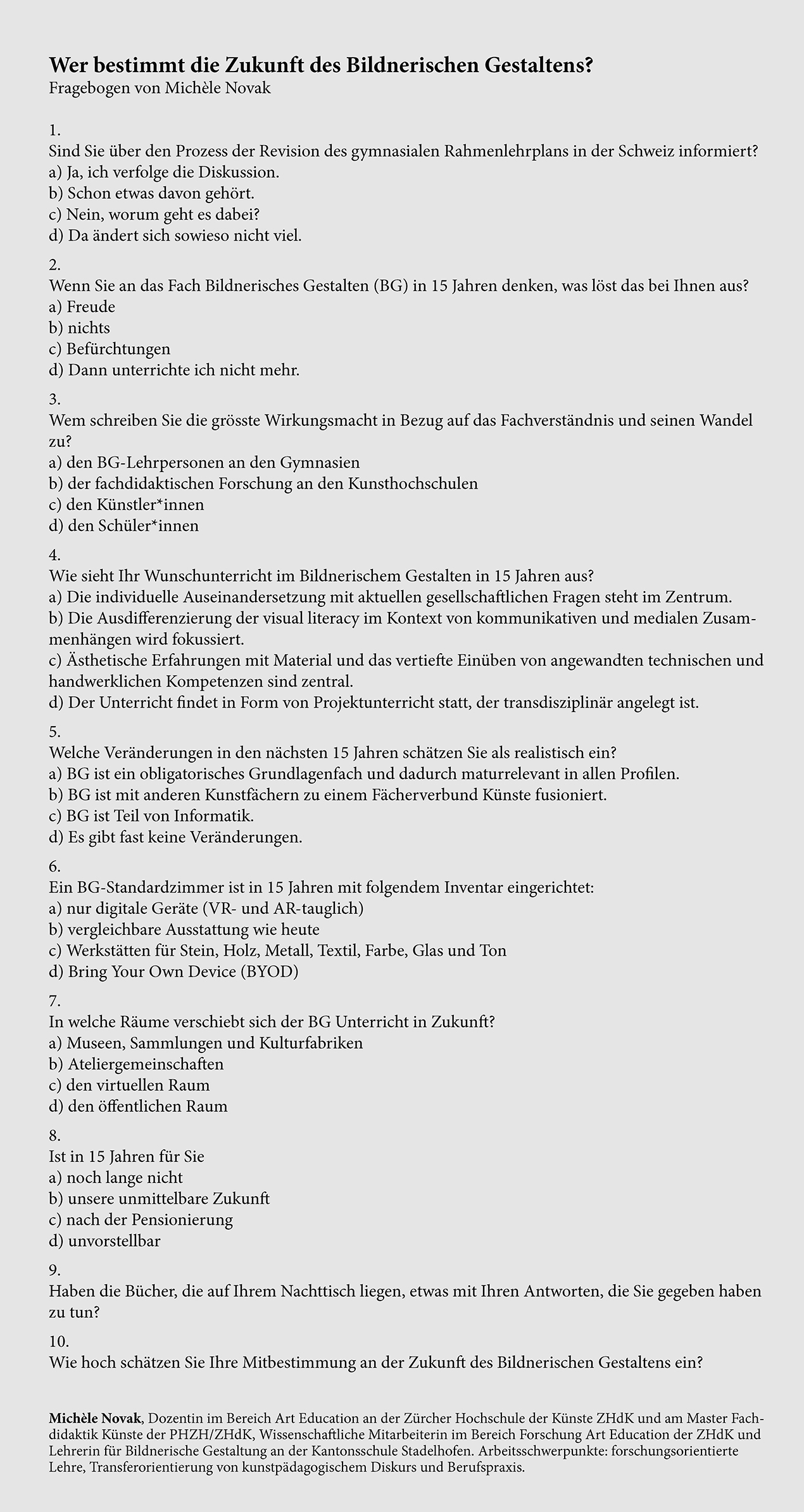
Literatur
Alkemeyer, Thomas/Buschmann, Nikolaus/Etzemüller, Thomas (2019): Einleitung. Gegenwartsdiagnosen als kulturelle Formen gesellschaftlicher Selbstproblematisierung in der Moderne. In: Alkemeyer, Thomas/Buschmann, Nikolaus/Etzemüller, Thomas (Hg.): Gegenwartsdiagnosen. Kulturelle Formen gesellschaftlicher Selbstproblematisierung in der Moderne. Bielefeld, transcript, S. 9-19.
EDK & WBF (2019): Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität. Bericht der Steuergruppe im Rahmen des Auftrags von EDK und WBF vom 6. September 2018 ‚Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität: Mandat für eine Auslegeordnung zu den Referenztexten‘, Bern, EDK/SBFI, online unter: https://www.edk.ch/dyn/12475.php [10.03.2021].
EDK & WBF (2020): Vademecum Projekt „Aktualisierung des Rahmenlehrplans“ Bern, EDK/SBFI, online unter: https://www.edk.ch/dyn/12475.php [10.03.2021].
Geulen, Christian (2020): „For Future. Zum Problem des vorauseilenden Denkens.“ https://geschichtedergegenwart.ch/for-future-zum-problem-des-vorauseilenden-denkens/ [10.03.2021].
Lemke, Thomas (2019): „Eine andere Vorgehensweise.“ Erfahrung und Kritik bei Foucault. In: Marchart, O./Martinsen, R. (Hg.): Foucault und das Politische. Politologische Aufklärung – konstruktivistische Perspektiven. Wiesbaden: Springer VS, S. 23-48.
Masschelein, Jan (2004): ‚Je viens de voir, je viens d’entendre.’ Erfahrungen im Niemandsland. In: Ricken N./Rieger-Ladich M.: Michel Foucault. Pädagogische Lektüren. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 95-115.
Masschelein, Jan/Quaghebeur, Kerlyn/Simons, Maarten (2004): Das Ethos kritischer Forschung. In: Pongratz, L./Wimmer/M., Nieke/W., Masschelein, J. (Hg.): Nach Foucault. Diskurs- und machtanalytische Perspektiven der Pädagogik. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 9-29.
Tenorth, Heinz-Elmar (2019): Zeitdiagnostik. Praktiken einer pädagogischen Argumentform. In: Berdelmann, K./Fritzsche, B./Rabenstein, K./Scholz, J. (Hg.): Transformationen von Schule, Unterricht und Profession. Wiesbaden, Springer, S. 93-112.
Thompson, Christiane (2004): Diesseits von Authentizität und Emanzipation. Verschiebungen kritischer Erziehungswissenschaft zu einer ‚kritischen Ontologie der Gegenwart.‘ In: Ricken N./Rieger-Ladich M.: Michel Foucault. Pädagogische Lektüren. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 39-56.
Thompson, Christiane (2007): Education and/or Displacement? A Pedagogical Inquiry into Foucault's ‘Limit‐Experience.’ In: Educational Philosophy and Theory, Vol. 42, No. 3, S. 361-377.
Literatur Fussnote
Brohl, Christiane (2003): Displacement als kunstpädagogische Strategie: Vorschlag einer heterotopie- und kontextbezogenen ästhetischen Diskurspraxis des Lehrens und Lernens. Norderstedt, Books on Demand.
Brohl, Christiane (2008): Displacement als ortsbezogene künstlerische Forschungspraxis. In: Brenne, Andreas (Hg.): „Zarte Empirie“: Theorie und Praxis einer künstlerisch-ästhetischen Forschung. Kassel, kassel university press, S. 34-51.
Foucault, Michel (1992): Andere Räume. In: Barck, Karlheinz et. al (Hg.), Aisthesis: Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Leipzig, Reclam, 34-46.
Klass, Tobias Nikolaus (2012): Politiken der Entortung: Rancière und Foucault. In: Hennigfeld, Ursula (Hg.): Nicht nur Paris. Metropolitane und urbane Räume in der französischsprachigen Literatur der Gegenwart. Bielefeld, transcript, S. 15-33.
Kraus, Anja (2013): Was zeigen uns die Dinge? Lernen als Displacement. In: Nohl, Arnd-Michael/Wulf, Christoph (Hg.): Mensch und Ding. Materialität pädagogischer Prozesse. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Sonderheft 25, Springer VS, S.154-170.
Schürch, Anna (2021): Eine Ontologie der Gegenwart. Zur Veränderung kunstpädagogischen Wissens. In: Art Education Research, e Journal der SFKP, Nr. 20. Zürich, Schweizerische Fachgesellschaft für Kunstpädagogik, SFKP.
- Zukunft: Anregungen für die Forschung in Art Education
- Herausforderungen einer Disziplinierung – Fragen an die Art Education
- ‹Natürliche Kunsterziehung› – Biologismen im kunstpädagogischen Diskurs
- Fachdidaktik, forschend:
- Editorial Art Education Research °11
- Materialien zum Selbststudium
- Quergelesen und zurückgesprochen
- Editorial Art Education °2
- Editorial Art Education °1